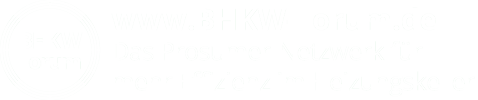Texas
ist mittlerweile eine Windmacht
Da gibt's von Tesla die Lade-Flat für 30$ im Monat
Texas
ist mittlerweile eine Windmacht
Da gibt's von Tesla die Lade-Flat für 30$ im Monat
Drum sollte ja sowas wie
netzentlaster.de
für jedes Verteilnetz dargestellt werden.
Hebelung der Marktpreise durch Modernisierung der NetzEntgeltVerordnung.
Jedes Netzgebiet hat ja seine Preise und wir müssen da weg von HT/NT und den hohen Leistungspreisen (nach Jahreshöchstlast).
Wenn hier z.B. bei
🟢 0ct/kWh
🟡 8ct/kWh
🔴 24ct/kWh
Entgelte anfallen, werden schnell Marktpreise der Kupferplatte ggf.(und nur bei Bedarf) überkompensiert.
aber zu dem Thema
gibts ja eigentlich einen anderen thread.
@Mods
ggf. Gunnars und meinen verschieben.
Nun ja,
die Pumpe vor Ort hängt an einer Steckdose ![]()
Vielen Dank
hier ist eine alpha2 auf Konstantdruck direkt installiert und die Dachse via Tichelmann parallel.
Wege sind sehr kurz.
Also baut die Pumpe einen Vordruck auf und die Thermostate im Dachs machen dann dicht, richtig?
....nicht, dass da Zwangsdurchströmung aufgebaut wird.
Thermostatpumpe...
ich muss es noch beobachten, aber vielleicht funktioniert es wie gehabt oder
wäre es besser z.B. auf kleine Magna zu wechseln und die auf Temperaturführung laufen zu lassen?
Dann müsst ich mich noch mit den Einstellugnen auseinander setzen....Jahrzehnte her, dass ich mich da ran setzte. Braucht man dafür PW für erweiterte Betreiber, oder gar Serviceebene?
Mehr als Tagzeiten anpssen ging nämlich nicht.
Fühler hab ich auch nur F1, T1 und T2 in Anzeige entdeckt.
Vielen Dank
Hallo meine Lieben,
ausnahmsweise Suchfaul bitte ich um Unterstütung.
Stand gerade an einer Dachs-Kaskade aus 3 Dachsen.
Diese sind parallel an eine gemeinsame Leitung angeschlossen und laufen von dort auf einen Puffer.
In dieser gemeinsamen Leitung ist eine Ladepumpe enthalten.
Muss das so?
Schieben die nicht allein rein, sondern über externe Ladepumpe?
Vielen Dank
Nun ja,
das Problem ist ja, dass all das vor 10 Jahren schon einmal aufm Tisch lag
spätestens als Dänemark ihr Einbauverbot durchdrückten...
Nun ist da einfach überhaupt nichts passiert
Hier wurde einfach zuviel Zeit verplempert und nun sind wir im Zeit- und Handlungsdruck.
Wenn ich immernoch an die Zeit zurück denk,
wo Lichtblick 2ct Extra-Bonus für Ihre BHKW aufgrund der Systemdienlichkeit wollten
und Politik die im Regen stehen ließ.....was hätte man damals damit alles erreichen können.
Über Strompreisbremsen,
subventionierte LNG-Terminals und neue Gaskraftwerke brächten wir wohl heut nicht zu diskutieren.
Dennoch
bleifreis Benzin war auch mal undenkbar, oder FCKW-frei Kältemittel
Vorgaben die an Verbote ranreichen halte ich durchaus für machbar.
Sind ja auch nicht das einzige Land der Welt, bei dem es so ist...
Im Neubau m.E. unstrittig
Bei Sanierung könte man m.E. mit Leistungsvorgabe (sind im GEG Entwurf mit 30% Heizlast auch vorgegeben) als bivalentes System zur Bedingung machen und per Jahresmengen überprüfbar.
Fördern könnte man z.B. auch Elekroinstallation (dürfte bei vielen ordentlicher Kostenblock sein, da TAB2018 jeder neue Schränke will) und z.B. "echte" WP-Tarife durch Entlastungen deutlich vergünstigen. Damit würde schon indirekt die Kunden freiwilig auf schaltbare Installationen(die wir für die Netzstabilität gern hätten) zurückgreifen.
Energiesteuer auf Gas könnte gerne rauf (find aktuell die Grenzübertrittspreise schon wieder zu billig)
aber die Energiesteuerbefreiung für KWK (die manche als fossile Subention beschreien) beibehalten
...das hatten wir vor 15Jahren schonmal als Ansatz für BHKW-Förderung die kein Steuergeld benötigt.
10 x 1 Millionen Wärmepumpen x 3 kW = 30 TW
Giga, nicht Terra...
10.000.000 Wärmepumpen x 3.000 W = 30.000.000.000 W = 30 GigaWatt.
Ja Danke da hat Kopfrechnen in der Nacht nicht richtig geklappt.
In Anbetracht dessen,
dass wir absolut regelmäßig die 30GW Lastwechsel haben,
halte ich das für absolut machbar....wenn die dann nicht zeitgleich mit den Spitzen laufen.
Da hier zwischendurch bezüglich Windkraft geschrieben wurde....
da bin ich dicht dran
und von der Masse brauchen wir uns da wohl keine Sorgen machen.
Kenne mittlerweile einzelne Repowering Projekte, wo 3 ältere Anlagen der 1MW Klasse abgerissen werden um gegen 1(!)ne neue der 5-6MW Klasse zu wechseln. Der Ertrag steigt dann um grob 500%
In weiten Teile Nord-/und Ostdeutschlands werden wir satte Überschüsse erwirtschaften.
Nur regional haben wir südlich der Main-Linie echte Probleme, da dort quasi nix vorhanden ist.
Klar kann man Stippen ziehen, aber da gabs auch schon Rechnungen, dass Bayern mehr Hochspannungsmasten bräuchte als Windräder. Kann man sich ja dann streiten, was den Blick aufs Gipfelkreuz mehr beeinträchtigt.
und zum Laufverhalten der WP -gerade bei kälteren- ATs
Ich denke hier ist ein echter Kritikpunkt am GEG-Entwurf angebracht.
Da wird für Hybridheizungen definiert, dass sichergestellt werden muss,
dass die WP primär zu laufen hat und erst wenn es nicht mehr reicht eine Spitzenlastquelle (klar vorgegeben als BW-Kessel) dazukommen darf.
bivalente Systeme kennen wir natülich als BHKW-ler,
aber so macht das hier m.E. keinen Sinn.
WP kann -dann sicherlich auch bei dichter Bebauung- doch gerne >+5°C AT Dauerläufer spielen.
Aber dann, wenn Leistungszahlt (<5°C) einbricht und der Aufwand viel größer wird (Rückkühler und Größe an sich)
die halt nicht mehr läuft und der Kessel alleine es bringt.
Im Jahresschnitt sollten dann dennoch grob 60-70% der Jahresheizarbeit aus WP geleistet werden
und damit wesentlichen Beitrag leisten können.
Positiver Nebeneffekt: Der Strombedarf würde eben nicht rapide -gerade zu Hochlastzeiten- ansteigen.
Also: Das zeitgleiche Laufen sollte raus und die Jahresmengen betrachtet werden. Das wäre m.E. viel sinnvoller, technisch einfacher und dem Ziel eines reduzierten fossilen Einsatzes auf keinem Fall im Wege stehen.
Langfristig
denke ich, dass wir signifikante, temporäre elektrische Überkapazitäten sehen werden und wohl selbst die Nachtspeicher eine Renaissance erleben werden.
KWK und GEG haben nichts miteinander zu tun, rihtig
...aber m.E. wird mit GEG explizit die Neuinstallation ausgeschlossen mit Zweck der Wärmebereitstellung
aber
...ich denk mit der Maßgabe DIN-V 18599 (das eigentliche Ziel des 65% Nachweises) könnte es klappen.
zum Ausgleich von Tagesschwankungen
...selbst mehrtägige (da durch E-Mobilität)
wäre ja auch auf der Verbraucherseite einiges zu stemmen. (Kleiner Verweis auf mein Signatur) ![]()
Nun aber zurück
zu GEG und KWK
was bedeutet denn
Ich kann mir unter der ersatzweisen Nutzung von Auf-Dach-PV wenig vorstellen...
im bisherigen GEG konnte man durch CO2-Gutschrift bei PV Anforderungen erfüllen (klassische Ersatzmaßnahme)
Was genau im Referenentenentwurf vom 03.04.2023 09:06 wäre das KO-Kriterium? Mir sind die 155 Seiten zwar auch ein wenig unübersichtlich, aber bis kurz nach Ostern gibt es ja noch Zeit, konstruktive Verbesserungsvorschläge einzureichen.
Gruß,Gunnar
Seite 100
Zu Doppelbuchstabe hh
Die neu in § 3 Absatz 1 Nummer 30a geschaffene Definition von unvermeidbarer Abwärme stellt sicher, dass für eine Anrechnung auf die 65-Prozent-EE-Vorgabe nach § 71
nur Abwärme berücksichtigt wird, die tatsächlich unvermeidbar ist, deren Anfall sich also technisch nicht vermeiden lässt und die sonst einfach an die Umgebung abgegeben werden müsste. Keine unvermeidbare Abwärme ist Nutzwärme aus KWK-Prozessen nach § 2 Nummer 26 KWKG, während Wärme aus der Rauchgaskondensation von KWK-Anlagen unvermeidbare Abwärme ist
Seite 114
Ersatzmaßnahmen sind nicht zulässig. Rein fossil betriebene Objekt-KWK-Anlagen oder Brennstoffzellen werden nicht zugelassen, ebenso wenig eine ersatzweise Nutzung von Auf-Dach-Photovoltaik oder weitere Effizienzmaßnahmen. Hybridlösungen – unter anderem auf Basis von KWK-Anlagen und Brennstoffzellen – werden nur dann möglich sein, wenn diese mindestens mit 65 Prozent grünen Gasen betrieben oder zur Erfüllung der 65-Prozent-EE-Vorgabe mit erneuerbaren Lösungen kombiniert werden