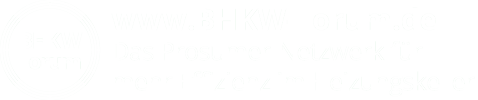Moin,
der ganze Text der ersten Absätze von EEG §9 (Technische Vorgaben) lautet wie folgt:
(1) Vorbehaltlich abweichender Vorgaben in einer aufgrund des § 95 Nummer 2 erlassenen Verordnung müssen die Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und die Betreiber von Anlagen, die hinter einem Netzanschluss mit mindestens einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes betrieben werden, sicherstellen, dass bei ihren Anlagen und KWK-Anlagen spätestens zusammen mit dem intelligenten Messsystem technische Einrichtungen eingebaut werden, die notwendig sind, damit über ein Smart-Meter-Gateway nach § 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetzes Netzbetreiber oder andere Berechtigte jederzeit entsprechend den Vorgaben in Schutzprofilen und in Technischen Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsgesetz
- die Ist-Einspeisung abrufen können und
- die Einspeiseleistung stufenweise oder, sobald die technische Möglichkeit besteht, stufenlos ferngesteuert regeln können.
(1a) Vorbehaltlich abweichender Vorgaben in einer aufgrund des § 95 Nummer 2 erlassenen Verordnung müssen die Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt und höchstens 25 Kilowatt, die nicht hinter einem Netzanschluss mit mindestens einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes betrieben werden, sicherstellen, dass bei ihren Anlagen spätestens zusammen mit dem intelligenten Messsystem technische Einrichtungen eingebaut werden, die notwendig sind, damit über ein Smart-Meter-Gateway nach § 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetzes Netzbetreiber oder andere Berechtigte jederzeit entsprechend den Vorgaben in Schutzprofilen und Technischen Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsgesetz die Ist-Einspeisung abrufen können.
(1b) [..]
(2) Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und technischen Einrichtungen im Sinne der Absätze 1 und 1a und unbeschadet weiterer Vorgaben im Zusammenhang mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes müssen Betreiber von
1. Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt sicherstellen, dass ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen ausgestattet sind, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen und die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann, oder
2. Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt sicherstellen, dass ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen ausgestattet sind, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann.
Zu (2)
Will Dein Netzbetreiber deine Doppel-Kleinstanlage wirklich fernsteuern oder muss er nur eine gesetzliche Pflicht formal erfüllen? Ich hab mir vor einigen Jahren sagen lassen, dass eine parallele Anforderung im Network Code 'Requirements for Generators', Verordnung (EU) 2016/631, im Artikel 13(6) auch so interpretiert werden kann, dass die in der englischen Sprachfassung "logic interface (input port)" genannte Schnittstelle auch in Form eines Überspannungsschutzes ausgestaltet werden kann. Diese P(U)-Funktion des Überspannungsschutzes kann durch eine U(P)-Funktion am Spannungsregler des Regeltrafos in Notfällen fernwirktechnisch ausgelöst werden.
Die Stromerzeugungsanlage muss über eine fernwirktechnische Schnittstelle (Eingangsport) verfügen, die es ermöglicht, die Wirkleistungsabgabe innerhalb von fünf Sekunden zu beenden, nachdem dort eine entsprechende Anweisung eingegangen ist. Der relevante Netzbetreiber kann Anforderungen an Betriebsmittel zur Fernbedienung dieser Vorrichtung festlegen.
Wegen des letzten Satzes kommt es stark darauf an, ob Dein Netzbetreiber nur eine lästige Pflicht erfüllen muss oder ob er ein intrinsisches Bedürfnis hat, Kleinstanlagen am Niederspannungsnetz fernzusteuern - oder ob er aufgrund einfacherer Verwaltungsvorgänge sowieso lieber die größeren Einspeiser über 100 kW abregelt, von denen er das aktuelle Einspeisezeitreihe kennt. Die Clearingstelle könnte hier ggf. mit Rat und Tat unterstützen, wenn man sie bittet, den gesetzlichen Sachverhalt zu analysieren. Sie könnte auch eine Auslegung anbieten, ob das "und" in "müssen Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt sicherstellen" so zu verstehen ist, je nach Interpretation der Verklammerung über das Inbetriebnahmedatum so zu veerstehen ist, dass sich das Schema
müssen Betreiber von (EEG-)Anlagen und Betreiber von KWK-Anlagen mit (jeweils) einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt sicherstellen
oder
müssen Betreiber von Anlagen aus dem Segment EEG und KWK mit einer kumulierten installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt sicherstellen
ergibt. Wie ist der Anlagenbegriff im EEG definiert? Sind EEG-Anlagen unterschiedliche Anlagen also KWK-Anlagen?
Gruß,
Gunnar