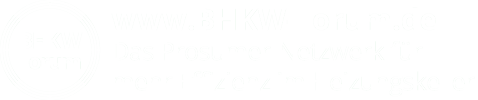Die puren Akkus (Eve A-grade) gibt es schon heute bei NKON für <€70/kWh. (ohne Märchensteuer). Wenn sich erst die Natrium-Akkus auch bei uns verbreiten, dann sehe ich die €10pro kWh schon früher als in 10 Jahren als realistisch an.
Damit läßt sich vieles abdecken, was sich heute nicht rechnet, aber richtige Saisonspeicher Sommer/Winter haben zu wenige Zyklen. Wenn ich die €10 Investition auf 20-50 Zyklen verteile, dann sind da die reinen Speicherkosten zu hoch.
Es bleibt ein Bedarf für große Speicherkapazitäten, die billigen Strom für lange Zeit kostengünstig speichern können. Da können auch große Umsetzungsverlusten in Kauf genommen werden, wenn der Ausgangsstrom entsprechend günstig wird (billig zu rechnen ist, siehe negative Strompreise)
Für mich stellt sich mehr die Frage, ob das Speichermedium unbedingt Wasserstoff sein muss, da ist das Speichern in großen Mengen halt auch nicht gerade billig.
![]()